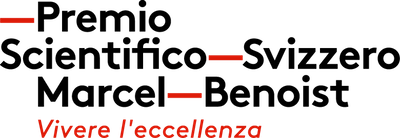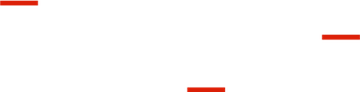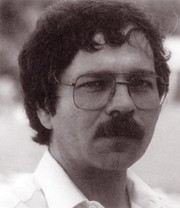
«Con questo premio la commissione riconosce l’eccellente lavoro di ricerca svolto nel campo delle alte temperature dei materiali superconduttori. Le loro scoperte hanno aperto nuove, inedite possibilità nei settori dell’elettrotecnica e della microelettronica.»
1911 entdeckte Kamerlingh Onnes die Supraleitung: Quecksilber, bei Zimmertemperatur ein schlecht leitendes Metall, leitet elektrischen Strom ohne Widerstand, wird es auf eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt (etwa -273 Grad) heruntergekühlt. Jahrelang wurde mit verschiedenen Metalllegierungen versucht, die ‘Sprungtemperatur’ – die Temperatur, bei der eine Verbindung supraleitend wird – zu erhöhen, da man annahm, nur ein sehr dichtes Material könne supraleitend wirken. M. und B. hingegen machten seit 1983 Versuche mit pulvrigen Oxydverbindungen und erzielten schliesslich im Januar 1986 den Durchbruch, indem sie mit einer Verbindung aus Lanthan, Barium, Kupfer und Sauerstoff die Sprungtemperatur auf -238 Grad anheben konnten. Ein grosser Vorteil der höheren Temperaturen, die seither erzielt worden sind, liegt darin, dass zur Kühlung nicht mehr das teure flüssige Helium verwendet werden muss, sondern diese mit dem viel billigerem flüssigen Stickstoff vorgenommen werden kann. Die Idee der beiden gab in der Folge Anlass zu einem wahren Wettlauf auf Verbindungen ähnlicher Art, da man sich in der ersten Euphorie ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten versprach. Genau dieser breiten technischen und kommerziellen Anwendbarkeit sind aber bislang Grenzen gesetzt: So ist es beispielsweise schwierig, das spröde Material zu verarbeiten, ohne dass dabei die Supraleitung verloren geht.